Globalisierung und Neoliberalismus
Mit der Französischen Revolution und verstärkt seit dem Aufkommen der Arbeiterbewegung schien das Geschick der Menschen der Hand des Allmächtigen nur zu entgleiten, um einem neuen, kaum weniger mächtigen Demiurgen in die Hände zu fallen. So erbittert in unserem Jahrhundert Faschisten, Kommunisten und Demokraten auch miteinander gerungen haben, was das zugrundeliegende Credo angeht, waren sich die verfeindeten Protagonisten immer einig: Wer die staatliche Maschinerie kontrolliert, kann im Guten wie im Bösen die Gesellschaft seinem freien Willen gemäß formen.
Das absolute Vertrauen in die etatistische Gestaltungskraft, wie es noch die sozialdemokratische Reform-Ära der frühen siebziger Jahre charakterisiert hat, ist aber mittlerweile in seinen Grundfesten erschüttert. Das hat gute Gründe und es fällt nicht schwer, zwei der zentralen strukturellen Ursachen für diese Entwicklung zu benennen. Zum einen zeigt sich seit dem Auslaufen des fordistischen Booms immer deutlicher, daß Staatsinterventionen keineswegs die basale Logik der Akkumulationsbewegung steuern und damit ökonomische Krisen ein für alle Mal aus der Welt schaffen können. Die unter dem Eindruck von Stalinismus und Faschismus entstandene und seitdem tausendfach wiedergekäute These der Kritischen Theorie vom Primat der Politik über die Ökonomie entpuppt sich als veritable Fehldiagnose. Zum anderen unterminiert das Weltmarktdiktat, sobald es mit der Vollendung des warenproduzierenden Systems zur allgegenwärtigen unmittelbaren Gewalt aufsteigt, die Basis der traditionellen einzelstaatlichen Souveränität und damit das reale Substrat der Politikreligion, nämlich die regulative Funktion des Staates im kapitalistischen Reproduktionsprozeß.
Die Nationalstaaten verfügten selbstverständlich immer schon nur über eine relative Handlungsautonomie. Angewiesen auf eine möglichst starke Stellung der eigenen Nationalwirtschaft in der internationalen Konkurrenz, konnten die etatistischen Apparate in die inneren Wettbewerbsbeziehungen der Warensubjekte letzten Endes nur soweit modifizierend eingreifen, wie diese Interventionen die internationale Position der noch wesentlich national organisierten Kapitalien direkt oder indirekt stärkten oder zumindest nicht untergruben. Der politischen Emphase war von daher — der Zusammenbruch des Sozialismus hat das handgreiflich gemacht — seit jeher ein illusionäres Moment eigen. Das darf allerdings nicht den Blick für die dramatischen qualitativen Veränderungen verstellen, die sich seit einigen Jahren Bahn brechen. Unter den Bedingungen des „globalisierten“ Kapitalismus wird die von allen nationalen Schranken befreite Kapitalbewegung für das einzelstaatliche Handeln zusehends selbst dort unmittelbar zur Schranke, wo Staatlichkeit nur ihrer traditionellen Aufgabe nachzukommen versucht und die weiteren Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen Reproduktion zu sichern bemüht ist. Angesichts einer neuartigen Kapitalmobilität tun sich Einzelstaaten immer schwerer damit, gegen die Logik der betriebswirtschaftlichen Kostenminimierung und Externalisierung jene Steuermittel aus dem Verwertungskreislauf abzuschöpfen, die sie als Garanten der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nun einmal benötigen und auch die Aufrechterhaltung von einheitlichen sozialen und ökologischen Standards wird zum strukturellen Problem.
Religionen verschwinden nicht ohne weiteres, nur weil sie ihre traditionelle Grundlage verlieren. Auch der Glaube an die Politik erweist sich als äußerst zäh und beginnt sich keineswegs zu verflüchtigen, sobald der säkulare Trend hin zur Paralyse der abstrakten Allgemeinheit, der heute unter dem Stichwort „Globalisierung“ durch die öffentliche Diskussion geistert, anfängt Konturen zu gewinnen. Vielmehr findet die Krise politischer Regulation zunächst einmal innerhalb der politischen Sphäre ihre provisorische Auflösung.
Am einfachsten läßt sich die schleichende Zersetzung staatlicher Steuerungsfähigkeit natürlich durch simple Leugnung der realen Entwicklung wegschieben. Insbesondere im sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Lager erfreut sich diese „Strategie“ bis heute denn auch recht großer Beliebtheit. Gerade die Kräfte, die den großen Etatisierungsschub der sechziger und siebziger Jahre getragen haben, neigen dazu, die Tragweite der gegenwärtigen Umwälzungen herunterzuspielen, um solange es geht und auch noch darüber hinaus business as usual zu betreiben.
Das gesamtgesellschaftliche Klima prägt seit den achtziger Jahren allerdings eine etwas raffiniertere und von daher auch erfolgreichere wie folgenreichere Variante der Verlängerung des Politikglaubens, nämlich dessen neoliberale Version. Diese hegemoniale Kraft bringt das Kunststück fertig, die Misere staatlicher Regulation, die sich seit dem Ende der siebziger Jahre abzeichnet, offensiv zu wenden und wiederum in die Sprache politischer Machbarkeit zu übersetzen, indem sie das Zurückweichen vor dem blinden Wüten der Marktlogik und die Abdankung der Politik paradoxerweise wiederum in den Rang eines politischen Programms erhebt. Der Neoliberalismus überspielt die sich abzeichnende Paralyse des Politischen, weil er den blanken Markt selber zur erstrebenswerten sozialen Ordnung ausruft und Deregulierung und Entstaatlichung zum expliziten ideologischen Ziel macht, das es gegen die bestehenden gesellschaftlichen Widerstände überhaupt erst willentlich durchzusetzen gilt. Die selbstläufige Logik der vollendeten Weltmarktgesellschaft tritt der Politik also nicht allein äußerlich gegenüber; sie hat in ihrem Innenleben in Gestalt einer breiten politisch-gesellschaftlichen Strömung auch noch einen fanatischen Anwalt.
Diese Verdoppelung ist für die Verlaufsform des „Globalisierungsprozesses“ und für die Art und Weise, in der die Paralyse staatlicher Regulation manifest wird, von entscheidender Bedeutung. Die paradoxe Verkehrung der bedingungslosen Kapitulation des Politischen in ein gesellschaftliches Pseudo-Reformprojekt wäre unmöglich, würde neoliberale Politik lediglich der normativen Kraft des Faktischen gehorchen, also sich allein damit begnügen, den jeweils bereits erreichten Stand der Zersetzung staatlicher Regulation einfach institutionell nachzuvollziehen. Die gnadenlose Unterwerfung unter das Marktdiktat kann sich nur als politisch-gesellschaftliches Gestalten gerieren, indem es als vorauseilender Gehorsam eine Vorreiterrolle übernimmt. Damit schiebt sich zwischen den stummen globalkapitalistischen Sachzwang und die gesellschaftliche Wirklichkeit aber allemal schon deren neoliberale Deutung. So verheerende Folgen die „Globalisierungsdynamik“ als solche auf Dauer auch zeitigen mag, ihre ganze Dramatik gewinnt die gegenwärtige Entwicklung erst durch all die „Anpassungsmaßnahmen“, mit denen die MarktChiliasten die „überfetteten“ Volkswirtschaften reif für den totalen Markt machen wollen. Bevor die „westlichen Wohlstandsgesellschaften“ die Gelegenheit haben, am Selbstlauf des Globalisierungsprozesses zu zerbrechen, gehen sie an den großartigen Fitnessprogrammen zugrunde, die ihnen die jeweiligen neoliberalen Dr. Eisenbart-Riegen präventiv angedeihen lassen.

Konkurrenz ohne Wechselkursventil
Wenn wir die Triadenregionen Nordamerika, Ostasien und (West)Europa betrachten, auf deren Märkte die Weltwirtschaft gerade im Rahmen dessen, was als „Globalisierung“ firmiert, immer mehr zusammenschrumpft, dann gilt diese Negativdiagnose vor allem für den Westteil unseres Kontinents. Das liegt nicht allein daran, daß in sämtlichen EU-Ländern dem staatlichen Sektor traditionell ein weit höheres Gewicht zukommt als etwa in den USA und deshalb deutlich mehr „etatistische Substanz“ zum Abschmelzen gebracht werden kann; in Europa gelten die laufenden, vom Geiste des Neoliberalismus inspirierten Umgestaltungsbemühungen außerdem einer Dimension, die bei den neoliberalen Machern andernorts in ihrem Traum vom entgrenzten Markt wohlweislich keine Rolle spielt. In der EU bezieht sich die angestrebte Umgestaltung nämlich auch auf das Niederreißen der Währungsschranken und greift damit eine der klassischen Grundvoraussetzungen jedes regulären staatlichen Handelns an, nämlich die Kongruenz von nationalem Währungsgebiet und nationalem wirtschaftspolitischem Bezugsrahmen. Wenn es nach dem Willen der führenden europäischen Regierungen geht, dann sollen die Einzelstaaten der Möglichkeit monetärer Regulation für ihr Wirtschaftsgebiet ein für allemal entsagen und eine Einheitswährung etablieren, auf daß innerhalb dieser Triadenregion die Marktteilnehmer künftig ihre Geschäfte auf einer vereinheitlichten monetären Basis abwik- keln können.
Aus der Perspektive der großen marktbeherrschenden europäischen Einzelkapitalien — ein anderer Standpunkt existiert für den Neoliberalismus ja nicht — macht die Erweiterung der laufenden Deregulierungsprogramme durch die monetäre Entgrenzung des europäischen Wirtschaftsraums durchaus ihren Sinn, mehr noch: Der Übergang zum Euro scheint sich fast unabweisbar aufzudrängen. Die EU hat sich in den letzten drei Jahrzehnten zu dem mit Abstand am dichtesten verflochtenen transnationalen Wirtschaftsraum der Erde entwickelt. In dieser Zeit haben aber makroökonomische Ungleichgewichte und spekulative Bewegungen das Wechselkursgefüge innerhalb dieses Blocks mehr als einmal derart durcheinandergewirbelt, daß dem betriebswirtschaftlichen Kalkül der kontinental operierenden Konzerne im nachhinein der Boden entzogen wurde. Die Währungsturbulenzen beispielsweise, die 1992 und 1993 zum Zusammenbruch des EWS führten, bedeuteten für deutsche, österreichische oder holländische Unternehmen nicht nur eine schlagartige Entwertung ihres in Spanien, Portugal oder Frankreich investierten Kapitals, sie zwangen gleichzeitig die in Aufwertungsländern beheimateten Warenexporteure dazu, in den Abwertungsländern bis auf Weiteres unter ihren Gestehungskosten zu verkaufen, wollten sie ihre Marktanteile dort behaupten. Wenn durch alle währungspolitischen Steuerungsmaßnahmen, mit denen die Europäer in den letzten 25 Jahren ihr Glück versucht hatten, solche Probleme nicht auszuschalten waren, liegt da nicht der Gedanke nahe, derartige Schwierigkeiten durch eine Währungsfusion ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen? Mit der Einschmelzung von Pfund, Franc, D-Mark, Lira und Schilling zu einer europäischen Einheitswährung würden schließlich ex definitione alle Wechselkursschwankungen zwischen diesen Währungen aufhören und die „continental players“ wären endlich in die Lage versetzt, zu einer von solchen Turbulenzen nicht mehr gestörten und daher optimierten „Allokation knapper Ressourcen“ zu finden, in der die Neoliberalen die Voraussetzung für reibungsloses Wachstum sehen wollen.
Diese simple Logik, die den Plänen der EWU-Befürworter zugrunde liegt, darf indes über die weitreichenden Folgen, die ihre Umsetzung nach sich ziehen muß, nicht hinwegtäuschen. Gerade bei den Abrißunternehmen dilettantischer Bauherren ist es gar nicht so selten, daß ihr realer Umfang im umgekehrten Verhältnis zu den eher bescheidenen ursprünglichen Plänen steht. So mancher Amateur hat beim Versuch, ein größeres Wohnzimmer zu schaffen, schon das ganze umgebende Gebäude zum Einsturz gebracht, nur weil er sich versehentlich bei seiner „Renovierung“ an einer tragenden Wand zu schaffen gemacht hat. Den genialen Umbauarchitekten, die Europa zum Wohl des freien Waren- und Geldflusses vom Währungshindernis befreien wollen, wird es keinen Deut besser gehen. Was aus einer engen betriebswirtschaftlichen Perspektive Sinn macht, kann sich vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus als vollkommen aberwitzig erweisen.
Den EWU-Protagonisten gilt in ihrer marktharmonistischen Weltdeutung die währungspolitische Zersplitterung des europäischen Wirtschaftsraums als Anachronismus, der im Widerspruch zum Fortschreiten der „europäischen Integration“ steht. Wer die europäische Entwicklung der letzten Jahrzehnte nicht durch diese ideologische Brille sieht, dem drängt sich indes eine gänzlich andere Interpretation auf. Bei einem „Integrationsprozeß“, der insofern nie einer war, als er die gravierenden Entwicklungsgefälle zwischen den beteiligten europäischen Volkswirtschaften eher versteilt denn eingeebnet hat, war die Existenz nationaler Währungen nie ein Hindernis, sondern im Gegenteil immer die unabdingbare Voraussetzung für die Zusammenfassung dieses Gebietes zu einem gemeinsamen Markt. Unterschiedlich produktive Volkswirtschaften können nämlich überhaupt nur ohne schützende Zollschranken und nichttarifäre Handelshindernisse in einem gemeinsamen Markt nebeneinander bestehen, wenn den schwächeren (weniger kapitalstarken) Teilnehmern wenigstens die Möglichkeit offen steht, durch periodische Abwertungen ihre Wettbewerbsnachteile partiell auszugleichen. Fällt dieser Kompensationsmechanismus in Europa weg und müssen alle Betriebe auf der Basis desselben Wertmaßstabes einander gegenübertreten, dann bedeutet dies für die traditionellen Weichwährungsländer die flächendeckende Abrasur ganzer Industriezweige.
Welche Bedeutung dem Wechselkursventil zukommt, läßt sich an der ostdeutschen Entwicklung recht eindrucksvoll ablesen. Wenn die DDR-Wirtschaft trotz gigantischer Transferleistungen die deutsch-deutsche Vereinigung nicht überlebte, während die wesentlich unproduktivere polnische Industrie zumindest im Kern die marktwirtschaftliche Transformation zunächst überstand, dann vor allem deshalb, weil Polen vor der überlegenen Konkurrenz Zuflucht beim Währungsdumping nehmen konnte, während die Ex-DDR zu ihrem umverteilungspolitischen Glück, aber industriestrukturellen Pech, Teil des bundesdeutschen Währungsgebietes geworden war. Dieses Grundproblem, an dem die Wirtschaft Ostdeutschlands nach 1990 zerschellte, wiederholt sich unweigerlich auch im EU-Rahmen. Daß Frankreich und Italien heute noch über einen eigenen Maschinenbau sowie eine chemische Industrie verfügen, verdanken sie einzig und allein dem Umstand, daß Lira und Franc vom Ende der sechziger Jahre bis 1992 ebenso beständigen Abwertungen gegenüber der D-Mark (der europäischen Ankerwährung) unterworfen waren wie das britische Pfund oder die spanische Peseta.
Der Verlust nationalökonomischer Kohärenz
Die Etablierung des „Euros“ verändert in allen Wirtschaftssektoren die Wettbewerbsbedingungen zugunsten einiger weniger kontinentaler Anbieter und beschleunigt dementsprechend enorm die Verdrängung von mittleren aber auch größeren Unternehmen, die auf den jeweiligen nationalen Markt ausgerichtet waren. Diese Entwicklung wird sicherlich mit einer weiteren regionalen Konzentration der Kernsegmente der europäischen Industrie, aber auch zentraler Dienstleistungsbranchen (Banken, Versicherungen) einhergehen. Das dürfte indes nicht nur eine Verschiebung der ökonomischen Gewichte zugunsten der bisherigen Hartwährungsstaaten in der EU bedeuten, sondern gleichzeitig zu einer krassen regionalen Polarisierung innerhalb aller bestehenden Nationalökonomien führen. Der Stärkung einiger im europäischen Binnenmarkt zentraler Agglomerations-Regionen steht die Ausdünnung der wirtschaftlichen Substanz von großen, zur bloßen Peripherie herabgedrückten Gebieten gegenüber. Gerade durch den Bedeutungsverlust der nationalen Märkte schrumpft die wirtschaftliche Aktivitätszone Europas zusehends auf jenen schmalen Gebietsstreifen, der in der volkswirtschaftlichen Diskussion meist als „blaue Banane“ apostrophiert wird, und vielleicht wenige zusätzliche Enklaven. Insbesondere der Süden des EU-Raums wird im Währungseuropa bis auf wenige Kernregionen abgehängt, und auch diesen Gebieten bleibt mit der Vernichtung der heimischen Binnenindustrien nur noch die Option, als Standorte verlängerter Werkbänke multinationaler Konzerne subalterne Teile von Wertschöpfung und Beschäftigung wieder an sich zu ziehen. Selbst diese Möglichkeit wird sich allerdings nur dann realisieren lassen, wenn die Beschäftigten mit großen Abstrichen beim Reallohnniveau und bei den Sozialstandards den volkswirtschaftlichen „Anpassungsdruck“, der einst in Abwertungen sein Ventil fand, selber übernehmen. Ansonsten werden es die westeuropäischen Konzerne wohl doch eher vorziehen, die arbeitsintensiven Teile der Produktion in Länder wie Tschechien oder Polen auszulagern, die ihre günstigen Lohnkosten für ausländische Unternehmen durch Währungsdumping absichern können.
Fanden in den siebziger Jahren und abgeschwächt auch noch im folgenden Jahrzehnt die innereuropäischen Entwicklungsgefälle noch ihren Hauptniederschlag in unterschiedlichen Inflationsraten und auseinanderdriftenden Wechselkursen, so müssen sie unter den Bedingungen der Einheitswährung in anderer Form zu Buche schlagen: entweder als sich versteilendes Sozialund Einkommensgefälle oder als extreme Ausdifferenzierung der Arbeitslosenraten (von der dritten theoretischen Möglichkeit großer Wanderungsbewegungen innerhalb Europas kann man angesichts der nach wie vor bestehenden großen kulturellen Unterschiede in diesem Zusammenhang wohl eher absehen).
Im neoliberalen Europa der Einheitswährung löst sich indes nicht nur die nationalökonomische Kohärenz der schwächeren Mitgliedsstaaten auf. Die Auslagerung zahlreicher arbeitsintensiver Fertigungsabschnitte aus dem europäischen Zentrum bedeutet gleichzeitig auch für die Länder, deren Territorium zu einem guten Teil zur „blauen Banane“ gehört, den Verlust tragender Beschäftigungssektoren. Auch in den „Gewinnerregionen“ bleiben breite Teile der Bevölkerung von der Teilnahme an diesen Erfolgen ausgespart.
Die Standortkonkurrenz der öffentlichen Hände
Um dem doppelten realwirtschaftlichen Polarisierungseffekt (Polarisierung zwischen den ehemaligen europäischen Nationalökonomien und regionale Polarisierung innerhalb der Einzelstaaten) auch nur ansatzweise gegenzusteuern, wären sowohl auf der gesamteuropäischen wie auf der einzelstaatlichen Ebene massive staatliche Programme notwendig. Die Etablierung der EWU verkleinert aber gerade nachhaltig den regulären Umverteilungsspielraum, der den öffentlichen Händen noch geblieben ist. Wo mit dem Währungsrisiko die letzten Hemmnisse für das anlagesuchende Kapital wegfallen, können sich die betriebswirtschaftlichen Einheiten in einem neuen Maße der Verantwortung gegenüber „ihrem“ Staat entziehen. Sie stehen nun vielen Anbietern „öffentlicher Güter“ gegenüber und verfügen über das Privileg, zwischen ihnen wählen zu können. Damit zerbricht die dreihundertjährige Ehe zwischen Territorialstaat und Kapital. Die Einzelstaaten geraten in einen neuartigen Wettbewerb um die Gunst von Investoren und Geldanlegern. Das wird zunächst einmal auf der Ebene des Steuerwesens spürbar. Wenn sich Betriebe und Geldkapitalbesitzer dank „outsourcing“, innovativer Buchführung und grenzenloser Freiheit des Kapitalverkehrs aussuchen können, in welchem europäischen Land sie ihre Abgaben entrichten wollen, haben es die Staaten zunehmend schwerer, den hochmobilen Faktor „Kapital“ überhaupt noch zu besteuern. Im Zugriff des Fiskus verbleibt langfristig nur mehr die Ware Arbeitskraft, der die notwendige Ausweichflexibilität naturgemäß abgeht.
Mit den sogenannten „Steuerreformen“, die derzeit im Vorfeld der EWU in vielen europäischen Ländern in Angriff genommen werden, unterwerfen sich die Regierungen bereits freudig dem selber geschaffenen „Sachzwang“. Bei den schon ergriffenen Maßnahmen wird es aber kaum bleiben. Aller Wahrscheinlichkeit nach bahnt sich ein regelrechter Steuerdumping-Wettlauf an. Ein einheitlicher Währungsraum, der aber kein homogenisiertes Steuersystem kennt, lädt nicht nur zum Ausnutzen der bestehenden Differenzen durch das Privatkapital förmlich ein, sondern auch zur Verfolgung von Sonderinteressen durch die Einzelstaaten. Insbesondere für kleinere europäische Länder wie Luxemburg, Belgien und Österreich wird es mehr denn je äußerst attraktiv sein, durch exorbitant niedrige Sätze massenhaft ausländische Steuerzahler und Geldanleger zu rekrutieren. Bei einer vergleichsweise kleinen Zahl einheimischer Steuerzahler werden die Steuereinbußen pro Kopf nämlich schnell durch Steuerzuwanderer überkompensiert. Es liegt auf der Hand, was das für die künftige Entwicklung der Staatsfinanzen in den größeren Flächenstaaten bedeutet.
Die gleiche Dumpinglogik, die dabei ist, die Grundlagen des „Abgabenstaates“ zu zerstören, bedroht natürlich auch den „Auflagenstaat“. Vom freien Flottieren des auf bedingungslose Kosten-Externalisierung konditionierten Kapitals geht ein immenser Druck zur Aufweichung ökologischer und sozialer Standards aus. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit und leerer Staatskassen wird sich unter dem Druck der EWU die innereuropäische Standortkonkurrenz allemal stärker erweisen als das soziale und ökologische Restgewissen.
Den neoliberalen Ideologen ist das natürlich nur recht. Mit der EWU rückt das, was sie sowieso schon lange anstreben, immer mehr in den Rang eines „Sachzwangs“. Die Äußerungen Norbert Bertholds vom renommierten Walter-Eucken-Institut über die zu erwartenden „Reformen des Sozialstaats“ im währungsvereinigten Europa sprechen Bände und können für eine ganze Strömung stehen: „Die These, wonach offenere Faktorenmärkte und mobilere Produktionsfaktoren in der EG den „Tod“ des europäischen Versicherungsstaates bedeuten, ist sicher richtig. Dies ist allerdings nicht negativ zu bewerten, sondern vielmehr erwünscht, kann doch das Gut „Sicherheit“ wesentlich effizienter auf privaten Märkten als durch den Staat produziert werden.“
Die Wachstumsillusion
Daß die Einführung des Euro mit verschärften Rationalisierungs- und regionalen Polarisierungstendenzen verbunden sein könnte, räumen die reflektierteren unter den Befürwortern der EWU durchaus ebenso ein wie den Verlust an nationalstaatlicher Steuerungsfähigkeit. Wie schon beim Übergang zum Binnenmarkt am Anfang des Jahrzehnts schwören sie indes Stein und Bein, derlei Effekte mit ihren negativen Wirkungen auf das europäische Beschäftigungsniveau würden durch die großartigen Wachstumsimpulse kompensiert, die sie der Einheitswährung zuschreiben. Auch diesmal dürfte sich allerdings eine solche Hoffnung schwerlich erfüllen. Selbst wenn die Beseitigung des Währungshindernisses die Wettbewerbssituation der in Europa beheimateten „global players“ tatsächlich nachhaltig verbessern würde, so könnte das erfolgreiche Auskonkurrieren der überseeischen Wettbewerber niemals auch nur annähernd so viel Beschäftigung schaffen, wie bei dieser Zurichtung der europäischen Wirtschaft auf die Globalisierungsbedingungen gleichzeitig vernichtet wird. Gerade weil das Gros des Außenhandels der EU-Staaten auf den europäischen Binnenhandel entfällt und die europäischen Staaten viel mehr untereinander als mit dem Rest der Welt verflochten sind, hängt die europäische Beschäftigungsentwicklung weniger davon ab, wie die Währungsunion die Wettbewerbsbedingungen zwischen den drei Triadenregionen verändert, als vor allem davon, welches Resultat die Verschärfung des Wettbewerbs innerhalb des europäischen Bezugsrahmens zeitigt. Wenn 1992 allein der Handel der 10 Millionen Niederländer mit den übrigen Mitgliedern der damaligen Zwölfer-Gemeinschaft den gleichen Umfang erreichte wie der Handel zwischen dem gesamten EU-Block und den USA und gar den mit Japan um das Zweieinhalbfache überschritt, dann werden die Proportionen deutlich, um die es hier geht. Es wäre absurd, wollte ausgerechnet der größte Binnenmarkt der Welt auf ein einseitiges gesamteuropäisches Exportmodell setzen. Aber genau in diese Richtung laufen die neoliberalen Phantasien, die europäische Wirtschaft durch eine radikale Verschlankung, sprich durch Sozialabbau und Lohnkostenminimierung, auf Kosten der Binnennachfrage genesen zu lassen.
Das EWU-Projekt als Flucht nach vorn
Angesichts der wenig erbaulichen Perspektiven, die sich aus dem Projekt Währungsunion insbesondere für die schwächeren europäischen Staaten ergeben, drängt sich unweigerlich die Frage auf, warum überhaupt die Regierungen Frankreichs, Italiens, ja selbst die irische, die portugiesische und die spanische Administration mit aller Gewalt ihre Aufnahme in die EWU anstreben. Die neoliberale Verblendung allein kann diese lemminghaften Ambitionen nur zum Teil erklären. Diesem Ehrgeiz liegt auch noch ein anderes gegenläufiges Motiv zugrunde. Das „Euro“-Projekt stellt auch den Versuch dieser Länder dar, aus den mit der Globalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte entstandenen währungspolitischen Dilemmata auszubrechen.
Bei den EWU-Plänen handelt es sich zweifellos um ein historisches Novum. Eine offizielle europäische Währung hat es bisher ebensowenig gegeben wie eine offizielle Europäische Zentralbank. Das darf indes nicht darüber hinwegtäuschen, daß de facto schon geraume Zeit mit der D-Mark eine privilegierte Bezugswährung existiert und daß die Verwalter dieser Währung längst als eine Art inoffizielle europäische Zentralbank fungieren, an deren Vorgaben sich sämtliche EU- Länder bei ihrer Geldpolitik notgedrungen orientieren müssen. Die Idee einer Einheitswährung läßt sich so gesehen aus der Perspektive ihrer vornehmlich in Frankreich und Italien beheimateten Initiatoren als Versuch verstehen, die bestehende asymmetrische Währungsstruktur aufzubrechen, indem sie die faktische Europawährung D-Mark mit dem „Euro“ durch eine offizielle ersetzen.
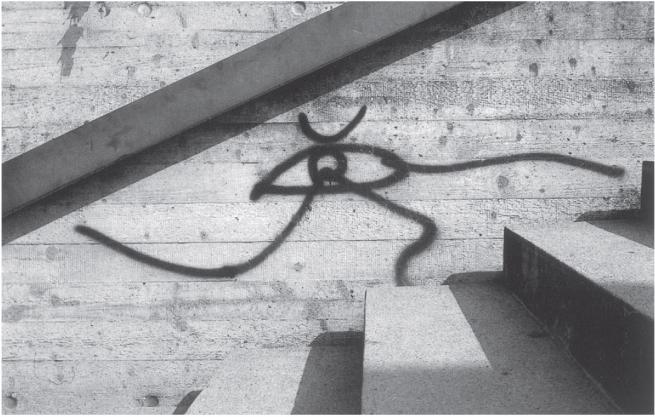
Die D-Mark-Hegemonie wurde erst mit der Globalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte in den letzten anderthalb Jahrzehnten zum Strukturproblem. In den siebziger Jahren, als Geldkapital noch im Überfluß vorhanden war, konnten die europäischen Länder ohne besonderes Augenmerk auf die Sicherung des Außenwerts ihrer Währungen eine eigene, an binnenwirtschaftlichen Zielen orientierte Geldpolitik betreiben. Im selben Maß, wie mit der Staatsverschuldung der Kreditbedarf der öffentlichen Hände wuchs, das internationale Realzinsniveau seit dem öbergang zu den Reaganomics sprunghaft in die Höhe schoß und die Abhängigkeit der Nationalökonomien vom transnationalen Finanzkapital eine neue Qualität erreichte, war es damit freilich vorbei. Unter den neuen Bedingungen mußte jeder Staat, der auch nur in den Verdacht geriet, er würde eine Abwertung der eigenen Währung in Kauf nehmen, unweigerlich damit rechnen, daß er dafür von den internationalen Finanzmärkten mit Kapitalabzug und entsprechenden einschneidenden „Risikozuschlägen“ bei den Zinsen abgestraft würde. Die Weichwährungsoption verlor damit ihre Attraktivität. Das Diktat der Finanzmärkte bedeutet aber — und das ist für unseren Zusammenhang zentral — gleichzeitig die unumschränkte Herrschaft der Lieblingswährung des transnationalen Geldkapitals in Europa. Der verschärfte Wettbewerb um günstige Refinanzierungs-Bedingungen zwang die europäischen Staaten nämlich nicht nur dazu, den Außenwert ihrer Währungen gegenüber der europäischen Ankerwährung auch auf Kosten der Binnenkonjunktur stabil zu halten; eine solche Orientierung auf festgezurrte Paritäten als ultima ratio jeder Geld- und Wirtschaftspolitik ließ sich überhaupt nur durchhalten, indem die europäischen Zentralbanken allesamt faktisch auf ihre Souveränität verzichteten und jede Maßnahme der deutschen Bundesbank brav nachvollzogen. Wenn die Frankfurter Währungshüter die Leitzinsen anhoben, um in Deutschland die Inflationsgefahr zu bannen, dann blieb Paris, Rom und Madrid nichts anderes übrig, als die gleichen Signale zu setzen — ohne Rücksicht auf die konjunkturpolitischen Folgen im eigenen Lande.
In einer solchen Situation kann es als verlockend erscheinen, die Flucht nach vorn anzutreten. Wenn seit der Globalisierung der Finanzmärkte das Wechselkursventil sowieso klemmt und nur mehr über heftige Währungskrisen vermittelt seine Funktion erfüllt, liegt es da nicht nahe, dieses Ventil ersatzlos auszubauen, um im Gegenzug durch die Auflösung der D-Mark in eine Kollektivwährung wenigstens wieder eine Hand ans entglittene geldpolitische Steuer zu bekommen? Dadurch werden aber nur neue Widersprüche hervorgetrieben.
Die neue deutsch-französische Feindschaft
Auch wenn die Befürworter der EWU noch so penetrant ihren Glauben an ein Zusammenwachsen Europas beteuern mögen, so sind in die EWU-Pläne doch völlig gegenläufige, miteinander unvereinbare Motive eingegangen. Die Währungsunion läßt sich als das Schlüsselprojekt der neoliberalen Offensive auf unserem Kontinent beschreiben; ihre Umsetzung würde eine Art Dammbruch bei der Herstellung des totalen Marktes auslösen. Gleichzeitig markiert sie aber auch den Versuch der schwächeren europäischen Länder, wieder einen gewissen Einfluß auf die Geldpolitik zu erlangen und das über die DM-Hegemonie vermittelte „Stabilitätsdiktat“ zu lockern. In einem wirtschaftspolitisch zersplitterten, aber währungsmäßig vereinten Europa hätten die nationalen Regierungen zwar nicht mehr die Möglichkeit zur autonomen Geldschöpfung, wie sie noch in den siebziger Jahren gegeben war; sie wären aber in die Lage versetzt, über exzessive Kreditaufnahme wieder so etwas wie eine Konjunktur- und Beschäftigungspolitik betreiben zu können. Diese Option ist umso verlockender, als die negativen Auswirkungen verstärkter staatlicher Verschuldung, nämlich steigende Zinsen an den Kapitalmärkten, das gesamte Währungsgebiet gleichermaßen treffen, also externalisiert würden, während die positiven Effekte internalisiert blieben. Die Inkongruenz von Währungsgebiet und wirtschaftspolitischem Bezugsrahmen, wie sie die Maastrichtverträge festschreiben, bereitet so gesehen einem äußerst prekären einzelstaatlichen Interventionismus den Boden. Es ist kaum zu erwarten, daß diese Gegenbewegung zum Traum von radikal verschlankter Staatlichkeit, deren praktisches Resultat nur in einem fatalen Verschuldungswettlauf zwischen den europäischen Einzelregierungen bestehen kann, angesichts der enormen sozialen und ökonomischen Folgelasten des Übergangs zur EWU eine bloß theoretische Möglichkeit bleiben wird. Vielmehr dürfte der Konflikt zwischen der neoliberalen und der neo-etatistischen Linie der Einzelstaaten die weitere praktische Entwicklung der EWU wesentlich bestimmen und die monetäre Haftungsgemeinschaft sehr schnell auf eine schwere Probe stellen.
Ein solcher Verlauf ist umso wahrscheinlicher, als sich diese Kollision schon im Vorfeld der Währungsunion abzeichnet. Wenn heute Bonn und Paris sich nicht auf ein gemeinsames Konzept für die praktische Ausgestaltung der EWU einigen können und die Frankfurter Bundesbank zusehends in die Schußlinie der französischen Öffentlichkeit rückt, dann handelt es sich dabei weder um bloß technische Detailfragen noch um die Privatfehde der beiden europäischen Vormächte; hier prallen bereits jene unvereinbaren Interpretationen über die Ausgestaltung der EWU aufeinander, die zu einer scharfen Polarisierung innerhalb der Währungsgemeinschaft führen müssen.
Die Bonner Regierung vertritt die neoliberale Option und imaginiert sich die EWU als eine Art erweiterten D-Mark-Raum. Sie will die Europäische Zentralbank dementsprechend auf eine Geldpolitik festgelegt sehen, die für das neue Euro-Label auf den Finanzmärkten das gleiche Wohlwollen wecken soll, dem der frischgebackene Verschuldungs-Europameister BRD seine privilegierten Kreditkonditionen verdankt. Diese Orientierung erzwänge allerdings massive Eingriffe in die Haushaltspolitik der europäischen Staaten und würde entsprechende „Nachbesserungen“ bei den Maastrichtvereinbarungen implizieren. Das läuft indes völlig den Intentionen insbesondere der französischen Partner entgegen, die für ihren Gehorsam gegenüber den Maastrichtkriterien mit stockendem Wachstum und einer mittlerweile auf über 13 Prozent angeschwollenen Arbeitslosigkeit bezahlen müssen und kaum gewillt sind, diesen Kurs ad ultimum fortzusetzen. Dementsprechend fand die Vorstellung automatischer Sanktionen, für die sich Bundesfinanzminister Waigel stark gemacht hatte, auf der Dubliner Konferenz der Regierungschefs im November letzten Jahres keine Mehrheit. Mehr noch: Westlich des Rheins mehren sich mittlerweile bis in die höchsten Regierungsstellen hinein Stimmen, die eine grundsätzliche Modifikation der reinen Stabiltätskultur einklagen. In diese Richtung weisen nicht nur die Pläne des französischen Finanzministers Arthuis (der neben der EZB einen „Stabilitäts- und Wachstumsrat“ der europäischen Regierungen installieren möchte, in dem die „Stabilitätssünder“ zweifellos in der Mehrheit wären), sondern auch die Versuche von Premierminster Alain Juppe, die alleinige Zuständigkeit der EZB für die europäische Geldpolitik auszuhebeln.

Die Tragweite des Konflikts zwischen Bonn und Paris läßt sich kaum überschätzen. Das gilt umso mehr, als Frankreich mit seiner Position mittelfristig kaum allein stehen wird und auf die stille Sympathie und Unterstützung der Mehrheit der europäischen Regierungen rechnen kann. Die spanische, die portugiesische und die italienische Administration sowie die Regierungen der anderen Wackelkandidaten können zu der für die Wirtschaft ihrer Länder mörderischen Hartwährungsoption, wie sie die Bonner Regierung vertritt, momentan noch keinen expliziten Gegenstandpunkt beziehen. Sie müssen sich vorläufig noch im alltäglichen Kotau vor den „Konvergenzkriterien“ üben, um überhaupt ihre Zulassung zur Währungsunion zu sichern. Bei ihrem Wohlverhalten gegenüber den Geboten der Stabilitäts-Simulation verlassen sie sich aber offensichtlich jetzt schon darauf, daß sich nach dem Inkrafttreten der Maastrichtvereinbarungen genug Möglichkeiten bieten werden, die feierlich unterschriebenen Stabilitätsverpflichtungen aufzuweichen, wenn erst die strukturellen Zwänge zur Subsumtion der eigenen Währungspolitik unter die Vorgaben der Bundesbank mit der Abschaffung der D-Mark verschwunden sind. Wie sonst läßt sich beispielsweise das Vorgehen der italienischen Regierung bei der Erfüllung der Konvergenzkriterien interpretieren? Wenn in den nächsten beiden Jahren eine Zwangsanleihe eingeführt wird, die zwar das laufende Budgetdefizit für diesen Zeitraum, wie im Maastrichtvertrag gefordert, unter 3 Prozent drücken soll, aber nach dem Eintritt in die EWU zurückgezahlt wird, dann hat das mit einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung wohl nicht allzuviel zu tun.
Das Stabilitätstheater
Angesichts der Entwicklung der bundesdeutschen Staatsfinanzen entbehrt es nicht einer gewissen Komik, wenn sich ausgerechnet die Bonner Administration und allen voran der für seinen virtuosen Umgang mit Schattenhaushalten weltbekannte Bundesfinanzminister Theo Waigel in die Pose der Stabilitätshüter werfen. Die Haushaltspolitik der BRD war zwar traditionell dank der starken Position des „Exportweltmeisters“ vergleichsweise solide; seit der Wiedervereinigung ist die BRD aber längst dabei, ihren relativen Verschuldungsrückstand beschleunigt aufzuholen. Wer gegenüber den unsicheren europäischen Kantonisten die bundesdeutsche „Stabilitätskultur“ ausspielen will, beschwört eine Vergangenheit und einen gewissen Ruf, aber keine dementsprechende haushaltspolitische Praxis mehr. Wenn der europäische Verschuldungswettlauf nach der Etablierung der EWU in eine neue Runde geht, wird sich Deutschland sicher einen Platz in der ersten Reihe sichern.
Dennoch hat die Beschwörungsformel, der „Euro müsse so stark wie die Mark“ werden, mit der die Bundesregierung für ihr Einheitswährungskonzept trommelt und das ganze groteske Stabilitätstheater, das sie dabei aufführt, durchaus ihre Logik. Der Euro kann zwar unmöglich die durch die starke realwirtschaftliche Position der Bundesrepublik gestützte Stellung der D-Mark in den siebziger und frühen achtziger Jahren übernehmen; er muß aber, koste es was es wolle, die allein durch das Blankovertrauen der Finanzmärkte gedeckte Pseudovitalität der D-Mark erben, wenn seine Einführung keine Währungskrise auslösen soll.
Unter den heutigen Bedingungen nachhaltig sich verschlechternder realwirtschaftlicher „fundamentals“ und einer negativen Zahlungsbilanz funktioniert die D-Mark-Stärke längst als eine Art Selbstläufer, der die BRD vorläufig noch gegen die Unbilden und Turbulenzen der realwirtschaftlichen Entwicklung abfedert. Allein die Tatsache, daß 20 bis 25 Prozent der Weltliquidität in D-Mark gehalten werden und weiterhin eine hohe Nachfrage nach dieser Währung herrscht, verschafft der BRD zu sehr günstigen Konditionen Zugang zum internationalen Geldkapital und erlaubt es ihr überhaupt, ihren enormen Refinanzierungsbedarf zu decken. Die BRD lebt als frischgebackener Megaschuldner also wesentlich von den Privilegien, die sie ihrer früheren Existenz als zweitgrößter Gläubiger auf der Welt verdankt. Dieser Mechanismus der Pseudostabilisierung wird aber in dem Augenblick unterbrochen und in sein Gegenteil verkehrt, in dem das Vertrauen in die künftige Stabilität dieser Währung nachläßt oder gar eine allgemeine Absetzbewegung aus ihr einsetzt. Sobald die im Ausland gebundenden DM- Massen die BRD überschwemmen, muß dies einen Entwertungsschub auslösen, der sowohl den Außenwert in den Keller sinken läßt als auch einen Inflationsschub zur Folge hätte und gleichzeitig zu einer Explosion der Zinssätze führen müßte.
So wenig sich ein objektiver Punkt angeben läßt, an dem das Blanko-Vertrauen der Finanzmärkte in die DMark in ein allgemeines Mißtrauen umschlagen wird, eins liegt auf der Hand: Der Übergang zum Euro wird in diesem Zusammenhang äußerst problematisch. Wenn die Finanzmärkte dem „Euro“ nicht die gleiche „Stabilität“ zutrauen wie der bisherigen europäischen Ankerwährung und wenn sie sich nicht bereit zeigen, ihre DM-Vermögen unbesehen zum 1. Januar 1999 in „Euros“ zu tauschen, dann wird dieses Mißtrauen unweigerlich zur self- fullfilling-prophecy, mit nicht absehbaren Folgen. Falls schon im Vorfeld der Währungsunion das Simulationstheater nicht mehr so recht greift, dürfte noch vor dem Jahr 1999 die DM- Herrlichkeit in einem Währungs-Crash ihr jähes Ende finden — und damit würden auch die EWU-Pläne platzen. Läßt sich die neoliberale Linie aber erst in den folgenden Jahren nach dem Übergang zur EWU nicht mehr durchhalten, so wird die sich selber verstärkende Abwärtsbewegung von Abwertung und Kapitalflucht dann auf der Basis der Einheitswährung einsetzen. Wie dem auch sei, sowohl die Fortschreibung der alten DM-Hegemonie unter dem Euro-Label als auch die Flucht nach vorn, der Versuch also, die Vorherrschaft der D-Mark via Euro zu brechen, können nur in einem Desaster enden.
