Es begann in den 20er Jahren. Amerikanische Konzerne wurden damals mit umfangreichen Krediten und Anleihen in Deutschland aktiv. Die Branchenführer der Elektroindustrie, Siemens & Halske und die AEG, nahmen 60 Millionen Dollar in Anspruch; die Stahlwerke zeichneten einen Kredit über 100 Millionen Dollar. Letztere entgingen nur deshalb dem Konkurs, weil britische und amerikanische Banken die Aktien der Vereinigten Stahlwerke im Ausland handelten.
Diese ungewöhnlichen Aktivitäten kamen nicht zufällig. Die größten Konzerne der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Deutschlands waren dabei, den Weltmarkt umzukrempeln. Zwischen 1926 und 1929 teilten sie die internationalen Absatz-, Finanz-, Investment- und Versicherungsmärkte unter sich auf, sicherten sich den Zugriff auf Kapital, Ressourcen und Arbeitskräfte. Die „international brotherhood“ des Kapitals war geboren — eine „brüderliche Vereinigung“ zu allseitigem Vorteil. Alle wollten sie die ungeliebte nationale Konkurrenz kleinhalten. Damit hatten sie auch Erfolg: Die „Internationale Rohstahlgemeinschaft“ z.B., in der sich die deutschen, amerikanischen und britischen Stahlgiganten zusammengeschlossen hatten, kontrollierte in den 30er Jahren 90% des internationalen Stahlhandels. Das strategische Ziel der „Brüderschaft“ war noch höher gesteckt — sie wollte die nationalen wie internationalen Wirtschaftskreisläufe kontrollieren und die Investitions- und Geldströme lenken.
Wie gut die Zusammenarbeit binnen wenigen Jahren funktionierte, zeigt der Zweite Weltkrieg. Die „brotherhood“ störte es wenig, daß Deutschland mit den Vereinigten Staaten und mit Großbritannien im Krieg lag. Für sie war der Krieg nur eine lästige Störung eingespielter Geschäftsbeziehungen. Erst kam der Profit, dann der Patriotismus.
Also ging die „brotherhood“ daran, ihre eigene Außenpolitik zu betreiben. Hinter dem Rücken Washingtons und Londons pflegten die angelsächsischen Konzerne weiterhin das „business as usual“ mit dem deutschen Kapital. Die Ökonomie wurde zum ständigen Dementi der Politik. Als die britische Regierung zum Schaden der deutschen Industrie eine Seeblockade über Lateinamerika verhängte, eilte die amerikanische Firma „Sterling Product“ zu Hilfe. Auf dem Umweg über die USA sicherte sie den IG Farben weiterhin den Zugang zum lateinamerikanischen Markt. Ein anderes Beispiel: Das britische Luftfahrtsministerium hatte Weisung erteilt, die Flugzeugproduktion drastisch zu erhöhen. Monate gingen ins Land, ohne daß etwas geschehen wäre. Kein zusätzliches Flugzeug rollte aus den Montagehallen. Der wichtigste Auftragnehmer, die Firma Zenith, war nämlich an Patentabsprachen mit ihren Partnern in den Vereinigten Staaten (Bendix) und Deutschland (Siemens) gebunden. Der Royal Air Force zuliebe wollte sie diese Kooperation nicht aufs Spiel setzen.
In tausenden von Dokumenten ist verbrieft, warum die „international brotherhood“ so handelte. Die Konzernplanungen waren auf Jahrzehnte ausgelegt; der Krieg aber würde in wenigen Jahren zu Ende sein. Warum also etwas riskieren? Die Geschäfte lebten davon, daß man diesseits wie jenseits des Atlantiks langfristig, zuverlässig und mit eingespielten Partnern planen konnte — „business as usual“ eben und über den Tag hinaus.
Gegen Ende des Krieges waren wichtige Politiker in den USA, Präsident Roosevelt, sein Finanzminister Henry Morgenthau und die linksliberalen „New Dealers“ in Justiz- und Finanzministerium, entschlossen, diesem Treiben ein Ende zu bereiten. Sie hatten die Ursachen des Zweiten Weltkrieges studiert: Um in die „international brotherhood“ aufgenommen zu werden, hatten deutsche Konzerne vabanque, also mit sehr hohem Risiko, gespielt. Weltmacht um jeden Preis war ihre Losung, ökonomische Hegemonie über Europa das kurzfristige Ziel. Jahr um Jahr bauten sie irrwitzige Überkapazitäten — auf die Stahlindustrie vornweg, gefolgt von der chemischen und der Elektroindustrie. Es kam, wie es kommen mußte. Märkte waren bald nicht mehr aufnahmefähig; Arbeitskraft wurde, da einseitig auf die dominanten Branchen konzentriert, vergeudet; Kredite wurden von den Kartellen abgeschöpft. Die deutsche Wirtschaft stand vor dem Kollaps. Krieg und Eroberung waren das vermeintlich letzte Mittel, um der Überakkumulation Herr zu werden. Also rüsteten die Deutschen zum Krieg.
Gescheiterte Entflechtung
Die Linksliberalen in Washington waren sich einig: dergleichen durfte nicht noch einmal eintreten. Deutschland mußte radikal entmilitarisiert werden. Nie wieder sollte es über die wirtschaftlichen Fähigkeiten verfügen, Krieg zu führen. Einige plädierten daher dafür, die Konzerne zu entflechten. Damit wäre die Quelle der Überakkumulation beseitigt gewesen. Andere, wie Henry Morgenthau, hielten dies für unzureichend und verwiesen auf die Erfahrungen der 20er Jahre. Mit List und Geschick waren damals die Manager der Stahl-, Chemie- und Elektroindustrie über die politischen Auflagen hinweggegangen, die im Versailler Vertrag niedergelegt waren. Überdies konnte die Technologie dieser Branchen mit wenigen Handgriffen von Friedens- auf Kriegsproduktion umgestellt werden. Also müßten Stahl-, Chemie- und Elektrowerke aus der deutschen Wirtschaft verbannt werden.
Jeder Vorschlag der Reformer war geeignet, die „international brotherhood“ aus den Angeln zu heben. Die Reformer wollten es nicht nur mit den Chefetagen in Düsseldorf, Essen, Köln oder Berlin aufnehmen, sondern auch mit jenen in Detroit, Pittsburg oder London.
Zunächst schien es so, als würden die Linksliberalen die Oberhand behalten. Die allgemeinen Richtlinien für die US-Zone vom April 1945 (JCS 1067) zielten darauf ab, die Leicht- und Konsumgüterindustrie beschleunigt aufzubauen. Die Produktion von Eisen und Stahl, von Werkzeugmaschinen und Fahrzeugen aller Art, von Radios und anderen elektronischen Ausrüstungen und von chemischen Erzeugnissen sollte auf ein „absolutes Minimum“ reduziert werden. Und im Potsdamer Abkommen vom August 1945 stand zu lesen: „Dem Ausbau der Landwirtschaft und der zivilen Industrien ist unbedingt Vorrang zu geben.“ Bekanntlich wurde daraus nichts, es blieb bei Absichtserklärungen. Warum dem so war, ist wenig untersucht und noch weniger bekannt. 40 Jahre Geschichtsschreibung zu diesem Thema haben mehr Erkenntnisse begraben als ausgegraben Das Scheitern der Reformer ist bis heute ein brisantes Thema. Dahinter verbirgt sich nämlich die — unbekannte — Gründungsgeschichte der Bundesrepublik.
Als die „New Dealers“ um Morgenthau und Harry Dexter White ihre Programme umsetzen wollten, hatten sich die Gegner bereits formiert. Es waren Gegner im eigenen Land und in der eigenen Regierung. Heftiger Widerspruch wurde von allen Seiten angemeldet, aus dem Kriegs- und Außenministerium, aus den Stäben des Weißen Hauses, aus den Reihen der gerade gebildeten Militärregierung für Deutschland. Die Kritiker verlangten unisono den „schnellstmöglichsten Wiederaufbau“ der deutschen Wirtschaft. „Keine Experimente“, lautete ihr Wahlspruch. Oder, so die rhetorische Frage an die amerikanische Öffentlichkeit, sollten etwa die Steuerzahler in den USA die Deutschen ernähren und letztendlich für ihren Sieg auch noch zur Kasse gebeten werden? Die solches aussprachen, waren allerdings nicht die Anwälte der amerikanischen Steuerzahler. Es waren die Anwälte der „international brotherhood“, Abteilung USA.
Big business macht Politik
Der Krieg hatte dem „big business“ in Washington Tür und Tor geöffnet. Als Roosevelt nach geeigneten Managern für die Kriegswirtschaft Ausschau hielt, waren die Konzerne zur Stelle. Sie stellten gleich dutzendweise Experten für den Dienst in der Regierung ab: Justitiare aus den großen Anwaltsbüros der Ostküste; Finanzexperten aus den Investmentbanken, Organisations- und Produktmanager aus den Großbetrieben. Die Liste des für den Krieg angeworbenen Personals liest sich wie ein „Who’s Who“ des US-Großkapitals. Clarence Dillon, James V. Forrestal und William H. Draper kamen von der New Yorker Investmentbank Dillon, Read & Co. Dillon & Read hatte in den 20er Jahren die Aktiengeschäfte mit der deutschen Industrie eingefädelt und den Löwenanteil der privaten Anleihen vermittelt. Einer ihrer besten Kunden in dieser Zeit waren die Vereinigten Stahlwerke. Die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell schickte die Brüder John F. und Alan Dulles nach Washington. Sullivan & Cromwell war bekannt als Interessensvertreter der IG Farben in den USA und betreute deren größte Niederlassung außerhalb Europas, die General Aniline and Film Corporation in Binghamton (New York). Auch die texanische Ölindustrie, die Stahlmagnaten, die Automobilkonzerne und die Elektroindustrie waren seit dieser Zeit in den politischen Apparaten Washingtons vertreten. Das effiziente Management des Krieges galt ihnen nun als Einstieg in die Politik. Ihr strategisches Ziel war viel anspruchsvoller: Sie wollten ein gewichtiges Wort bei der Gestaltung der Nachkriegswelt mitreden.
Der Krieg war kaum zu Ende, als ein heftiger Kampf um Ämter und Stellungen in der neugebildeten Militärregierung für Deutschland (OMGUS) entbrannte. Linksliberale und „big business“ wußten, daß die Weichen für die ökonomische Zukunft Deutschlands und Europas in den Besatzungszonen gestellt würden. Washington war weit; ob die Richtlinien des Weißen Hauses in Geist und Buchstabe befolgt würden, hing davon ab, wer vor Ort das Sagen hatte.
Der Kampf um Deutschland
Die Reformer waren hauptsächlich in der Finance Division und in der Decartelization Branch der Economics Division der Militärregierung Deutschland (OMGUS) vertreten; die „international brotherhood“ hatte die übrigen Abteilungen der Economics Division fest in der Hand. William D. Draper war ihr Geschäftsträger in Berlin. Die Linksliberalen mußten die Initiative ergreifen, wollten sie etwas erreichen. Sollte es ihnen nicht gelingen, Ort und Zeit der Reform zu bestimmen, standen sie auf verlorenem Posten. Ihre Gegner hatten leichtes Spiel; für sie war viel gewonnen, wenn sie erfolgreich störten und verzögerten.
Die „international brotherhood“ hatte sich auf die neue Aufgabe gut vorbereitet. Fast alle Mittel waren ihr recht, um Eingriffe in die deutsche Wirtschaft abzublocken — aber nur wenige so wirksam wie der bürokratische Guerillakrieg. Es genügte, in kurzen Abständen Sachbearbeiter auszutauschen und Kompetenzen neu zu verteilen; oder neue Richtlinien für die Beratung und Verabschiedung von Direktiven auszugeben. Das gewünschte Ereignis stellt sich immer ein. Anträge wie Anweisungen blieben wochen-, oft monatelang im bürokratischen Gestrüpp hängen. So rächte sich, daß die Reformer in allen Bereichen unterbesetzt waren. Sie hatten nicht genügend Personal, um derlei Winkelzüge zu unterbinden. Das wußte auch die Gegenseite. Regelmäßig wurden Anträge der Finance Division zurückgewiesen, neue Mitarbeiter einzustellen — Sabotage auf dem Behördenweg. Die Personalpolitik im OMGUS-Hauptquartier hatte größeren Einfluß auf die Geschicke der besetzten Zonen als alle diplomatischen Noten, die zwischen Moskau, Washington, London und Paris ausgetauscht wurden.
Das amerikanische „big business“ fand in der britischen Militärregierung loyale Mitstreiter. Deren Economics Division wurde (bis Ende 1946) von Sir Percy Mills geleitet — Repräsentant von ICI (International Chemical Industries) und Manager in einem internationalen Verbund von Chemiekonzernen, dem von deutscher Seite die IG Farben und von amerikanischer Seite DuPont angehörten. Die britisch-amerikanische Kooperation klappte hervorragend, wenn es galt, im Koordinierungsausschuß des Alliierten Kontrollrates die Anträge der Linksliberalen zu Fall zu bringen. Auf den ersten Blick wirkten Beratungen dieses Gremiums zum Entflechtungsgesetz, zur Währungsreform, zu Produktionsquoten, zur Rohstoffverteilung oder Lizenzvergabe chaotisch. Aber das Chaos hatte System. Die Sachwalter der „international brotherhood“ spielten, ohne es offen auszusprechen, mit verteilten Rollen. Mal legte die Economics Division der Briten ihr Veto ein, mal jene der Amerikaner. „Same procedure as last time“: Unerwünschte Initiativen liefen ins Leere, wurden vertagt, erneut diskutiert und schließlich, wenn überhaupt, in einer Form verabschiedet, die mit dem ursprünglichen Anliegen nichts mehr zu tun hatte. Die nicht geglückte „Entflechtung“ der IG Farben mag als Hinweis genügen.
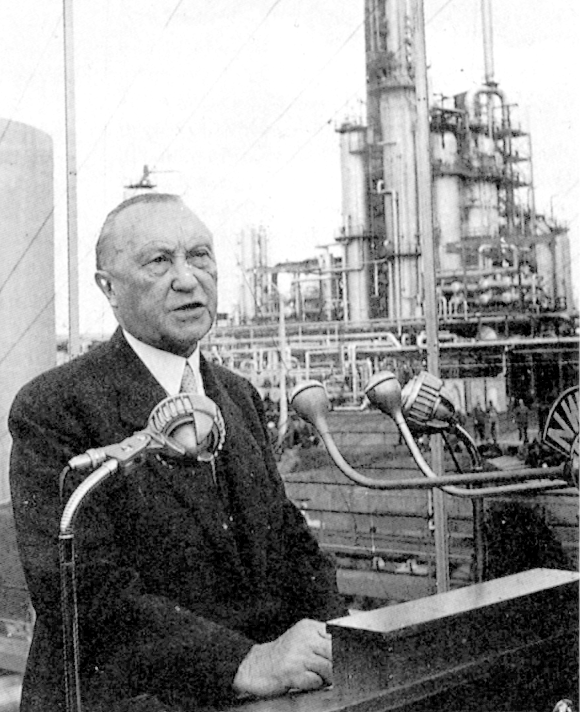
Die Würfel sind gefallen
Derweil konnten sich die „deutschen Wirtschaftsführer“ in aller Ruhe auf ihre neue Rolle vorbereiten. Es dauerte nicht lange, und Sprecher der amerikanischen Militärregierung traten öffentlich gegen eine Entnazifizierung der Wirtschaft auf. Amerikanische Geschäftsleute und Journalisten wurden nach Deutschland eingeladen und vor Ort „betreut“. Wie sollte dieses Land wieder auf die Beine gebracht werden — ohne die tätige Mithilfe der alten Experten, ohne ihr „know how“ und ihre Erfahrung? Wieso sollten Geschäftsleute für die Politik und Verbrechen der Nazis bestraft werden? Hinter der rhetorischen Fassade lauerte die Sorge um die Zukunft der „international brotherhood“. Wenn erst einmal die großen Konzerne in Deutschland zerschlagen waren, mußte damit gerechnet werden, daß die Linksliberalen auch im eigenen Land tätig würden. Wer wollte dann noch General Motors, DuPont, General Electric, IBM, Standard Oil, US Steel Bethlehem, Republic Steel, Procter & Gamble, International Harvesters und wie sie alle hießen (und heißen), vor dem „trust busting“ (Konzernentflechtung) schützen? Die Rettung der deutschen Manager war so gesehen auch eine soziale Vorsorge für die amerikanischen Bosse. Daß die deutschen Kapitalisten in den 20er Jahren va-banque gespielt und mit ihrer ruinösen Wirtschaftpolitik den Weg in den Krieg gepflastert hatten, spielte dabei selbstverständlich keine Rolle.
Zur Jahreswende 1946/47 waren die Würfel gefallen. Während das offizielle Washington noch blumig von „Entflechtung“ und „Entmilitarisierung“ sprach, war die Restauration des deutschen Kapitalismus in vollem Gang. Wieder einmal hatte die „international brotherhood“ bewiesen, daß sie auf eigene Faust Außenpolitik betreiben konnte — die Ökonomie dementierte die „große Diplomatie“. Als wenige Monate später auch noch der Kalte Krieg begann, hatten die Reformer endgültig verloren. Es war, so schrieb James Stewart Martin nach seinem Rücktritt als Leiter der Decartelization Branch, als litte der „Patient Deutschland“ nicht nur an Typhus, sondern hätte sich auch noch eine Lungenentzündung geholt. Die meisten Linksliberalen in der Militärregierung quittierten im Sommer 1947 den Dienst. Kaum in die USA zurückgekehrt, konnten sie die Erklärungen ihrer Nachfolger in der Presse lesen. Darunter jene, daß die westdeutsche Wirtschaft zu einem „Bollwerk gegen den Sowjetkommunismus“ ausgebaut werden sollte.
Die Niederlage der Linksliberalen markiert einen historischen Einschnitt. Dieses Datum zählt — weil es erklärt, wie und warum die neue Republik vorbereitet wurde. Es ist ein Symbol für die Politik der „international brotherhood“, die geräuschlos und ohne nach außen in Erscheinung zu treten, die Weichen gestellt hat. Währungsreform und Gründung der Bundesrepublik folgten erst später. Sie waren keine Zäsuren mehr, nur noch Stationen auf einem vorgezeichneten Weg. Warum sich also erinnern? Es lohnt sich allenfalls, wenn der Blick frei bleibt dafür, wie die herrschende Klasse den Nachkrieg plante und wie sie ihre Ideen nach dem 8. Mai 1945 in die Tat umsetzte.


